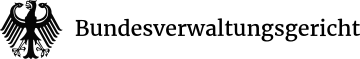Urteil vom 11.12.2003 -
BVerwG 7 C 19.02ECLI:DE:BVerwG:2003:111203U7C19.02.0
Leitsätze:
Solange für potentiell gesundheitsgefährdende Stoffe keine Immissionswerte bestimmt sind, dienen zur Minimierung des Gesundheitsrisikos erlassene Emissionsgrenzwerte auch dem Schutz eines individualisierbaren Personenkreises im Einwirkungsbereich der Anlage.
Im Rahmen des Minimierungsgebots endet die Schutzpflicht regelmäßig dort, wo aufgrund sachverständiger Risikoabschätzung die Irrelevanz einer von der Anlage verursachten Immissionszusatzbelastung durch potentiell gesundheitsgefährdende Stoffe anzunehmen ist.
Eine Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache tritt nicht ein, wenn im Lauf des Prozesses ein Emissionsgrenzwert herabgesetzt und die Klage gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung in der geänderten Gestalt fortgeführt wird.
-
Rechtsquellen
BImSchG § 5 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2; § 48 TA Luft (1986) Nr. 2.3 VwGO § 116 Abs. 2; § 161 Abs. 2 -
Instanzenzug
VGH Mannheim - 18.12.2001 - AZ: VGH 10 S 2184/99 -
VGH Baden-Württemberg - 18.12.2001 - AZ: VGH 10 S 2184/99
-
Zitiervorschlag
BVerwG, Urteil vom 11.12.2003 - 7 C 19.02 - [ECLI:DE:BVerwG:2003:111203U7C19.02.0]
Urteil
BVerwG 7 C 19.02
- VGH Mannheim - 18.12.2001 - AZ: VGH 10 S 2184/99 -
- VGH Baden-Württemberg - 18.12.2001 - AZ: VGH 10 S 2184/99
In der Verwaltungsstreitsache hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom 11. Dezember 2003
durch die Richter am Bundesverwaltungsgericht G ö d e l , K l e y ,
H e r b e r t , K r a u ß und N e u m a n n
für Recht erkannt:
- Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 18. Dezember 2001 wird zurückgewiesen.
- Der Kläger trägt die Kosten des Revisionsverfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen.
I
Der Kläger verlangt die Aufhebung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, hilfsweise die Verpflichtung des Beklagten, weitere Schutzmaßnahmen festzusetzen.
Die Beigeladene beantragte am 21. Februar 1995 die Genehmigung zum Betrieb ihrer bestehenden Laboranlage als Anlage zur fabrikmäßigen Herstellung ultrafeiner Metall- und Keramikpulver (Nanopulver); als Jahresproduktion des aus verschiedenen Ausgangsstoffen im CVR-Verfahren (Gasphasenreaktion) hergestellten Nanopulvers mit Partikelgrößen von 1 bis 100 nm wurden maximal 15 t angegeben. Der in der Nachbarschaft der Anlage wohnende Kläger erhob fristgerecht Einwendungen gegen das öffentlich bekannt gemachte Vorhaben. Nach Durchführung eines Erörterungstermins und Einholung mehrerer Stellungnahmen und Gutachten erteilte der Beklagte mit Bescheid vom 23. Juli 1996 die beantragte Genehmigung; nach den beigefügten Nebenbestimmungen dürfen in der Anlage die Elemente Cadmium, Quecksilber, Thallium und Beryllium sowie Verbindungen dieser Elemente nicht zum Einsatz kommen, die in Anlage II der Störfallverordnung aufgelisteten Stoffe nur in einer Menge von weniger als 10 % der Mengenschwelle der Spalte 1 für die jeweiligen Stoffe gelagert oder gehandhabt werden und die Emissionen an Gesamtstaub einen Massenstrom von 17,5 g/h sowie die darin enthaltenen Teilchen mit Partikeldurchmesser unter 100 nm eine Massenkonzentration von 50 μg/m³ nicht überschreiten; für bestimmte Stoffe sind weitere Emissionsgrenzwerte festgesetzt. Die Emissionsgrenzwerte sind an der Probenahmestelle im Kamin einzuhalten, beziehen sich auf Abgas im Normzustand und sind - ausgenommen Werte für Dioxine und Furane - als Stundenmittelwerte zu ermitteln. Die Einhaltung der Emissionsbegrenzungen ist nach Maßgabe des § 26 BImSchG durch regelmäßige Messungen nachzuweisen.
Nach erfolglosem Widerspruch hat der Kläger beim Verwaltungsgericht Freiburg
Klage erhoben und zur Begründung ausgeführt: Angesichts des neuartigen Gefährdungspotentials zellwandgängiger Nanopartikel drohe eine erhebliche Beeinträchtigung seiner Gesundheit. Die von der Anlage ausgehenden Emissionen seien durch die vorgenommenen Messungen nicht hinreichend erfasst worden. Gegenüber dem hierbei angewendeten rasterelektronischen Verfahren (REM) sei das Verfahren zur Ermittlung der Partikelgrößenverteilung durch elektrische Mobilität (DMPS) vorzugswürdig. Die Messungen seien auch nicht repräsentativ, erforderlich sei eine Dauerüberwachung. Die toxikologische Bewertung im Gutachten von Prof. Dr. B. (Universität ..., Institut für Hygiene und Arbeitsmedizin) sei unzulänglich, weil ihr nur wenige, vergleichsweise unproblematische Stoffe aus der breiten, wesentlich gefährlichere Stoffe enthaltenden Produktpalette zugrunde lägen. Es hätte eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt und Vorsorge für Störfälle getroffen werden müssen.
Das Verwaltungsgericht hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens von Prof. Dr. G. (Technische Universität ..., Institut für Toxikologie und Umwelthygiene) die Klage abgewiesen: Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei mangels funktionalen Anlagenverbunds nicht erforderlich gewesen. In der Sache verletze die Genehmigung den Kläger nicht in seinen Rechten, weil eine Verletzung der Schutzpflicht des Betreibers ausgeschlossen werden könne. Für Nanopartikel seien weder in der TA Luft noch in sonstigen Regelwerken Grenzwerte festgelegt. Die von der Anlage verursachte Zusatzbelastung durch Nanopartikelimmissionen sei irrelevant. Die Einwendungen des Klägers gegen die der Irrelevanzbetrachtung zugrunde liegenden Emissionsmessungen seien unbegründet. Mangels bekannter Wirkungsschwellen für Nanopartikel könne der Beurteilungswert für Dieselruß herangezogen werden, weil Dieselruß nach seiner Korngrößenverteilung und in toxikologischer Hinsicht mit dem von der Anlage ausgehenden Nanostaub vergleichbar sei. Dass in der Anlage erheblich gefährlichere Stoffe als Dieselruß produziert werden könnten, sei nicht ersichtlich. Das Abluftreinigungssystem entspreche dem Stand der Technik. Gegen Betriebsstörungen sei hinreichende Vorsorge getroffen. Die Einhaltung des Vorsorgegrundsatzes sei wegen fehlender Drittschutzwirkung nicht zu überprüfen.
Der Kläger hat gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Berufung eingelegt, die der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg zugelassen hat. Im Berufungsverfahren hat die Beigeladene mit Änderungsanzeigen vom 14. August 2001 die herstellbare Produktpalette beschränkt und den Emissionsgrenzwert für Nanopartikel von 50 μg/m³ auf 0,5 μg/m³ herabgesetzt. Der Beklagte hat der Beigeladenen mitgeteilt, dass die Änderungen keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen. Der Kläger hat im Umfang der Änderungsanzeigen die Hauptsache für erledigt erklärt und im Übrigen seinen Klageantrag weiterverfolgt. Der Beklagte und die Beigeladene sind dem Erledigungsantrag entgegengetreten.
Der Verwaltungsgerichtshof hat nach Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. W. (Universität ..., Institut für Epidemiologie, GSF Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit) die Berufung zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt: Die Änderung der angefochtenen Genehmigung im Lauf des Berufungsverfahrens habe keine Teilerledigung des Rechtsstreits bewirkt. In der Sache stelle die Genehmigung sicher, dass die Beigeladene die ihr gegenüber dem Kläger obliegende Schutzpflicht erfülle. Die auf den Kläger einwirkenden, durch den festgesetzten Emissionsgrenzwert für Nanopartikel zugelassenen Immissionen seien nicht geeignet, ihn in seiner Gesundheit zu gefährden. Die aufgrund einer Ausbreitungsrechnung der Landesanstalt für Umweltschutz ermittelte Immissionszusatzbelastung sei im Rahmen des Schutzgebots als irrelevant anzusehen. Die Ausbreitungsrechnung sei im Ergebnis zutreffend, doch seien ihr nicht die tatsächlich gemessenen Emissionswerte, sondern der in der Genehmigung festgesetzte Emissionsgrenzwert zugrunde zu legen, sofern nicht offensichtlich sei, dass dieser von vornherein nicht eingehalten werden könne. Da die Ausbreitungsrechnung davon ausgehe, dass die Größe der emittierten Partikel unverändert bleibe, komme es nicht darauf an, ob das Wohnhaus des Klägers der Emissionsquelle näher liege als der Ort des ermittelten Immissionsmaximums. Eine Ausbreitungsrechnung, die eine Agglomeration von Partikeln und damit deren Vergrößerung unberücksichtigt lasse, führe nach Auffassung des Sachverständigen Prof. Dr. W. eher zur Überschätzung ihrer Anzahlkonzentration. Auf der Grundlage der nachvollziehbaren Ausführungen des Sachverständigen sei das Gericht davon überzeugt, dass mangels hinreichender wissenschaftlicher Erkenntnisse über die gesundheitsgefährdenden Wirkungen von Nanopartikeln, die infolge ihrer Aufnahme über den Atemweg vor allem in Entzündungen und Herz-Kreislauf-Problemen, möglicherweise auch in einem Krebsrisiko bestehen könnten, und angesichts fehlender Grenzwerte oder Beurteilungswerte Gesundheitsgefahren durch Nanostaubimmissionen aufgrund einer Irrelevanzbetrachtung auszuschließen seien. In Bezug auf mögliche kanzerogene Wirkungen von Nanopartikeln sei dem Minimierungsgebot dadurch genügt, dass der Beklagte der Beigeladenen die Einrichtung eines mehrstufigen und redundanten Abgasreinigungssystems aufgegeben habe, das dem Stand der Technik entspreche. Unabhängig hiervon sei eine Rechtsverletzung des Klägers zu verneinen, weil die vom Kläger befürchteten Gesundheitsrisiken dem Vorsorgebereich zuzuordnen seien; es sei nicht erkennbar, dass der Anlagenbetrieb im Rahmen der Genehmigung Nanostaubimmissionen verursache, die nach derzeitigem Stand der Wissenschaft zur Herbeiführung von Gesundheitsgefahren geeignet seien. Mangels drittschützender Wirkung der immissionsschutzrechtlichen Vorsorgepflicht habe der Kläger keinen Anspruch auf eine über die Genehmigungsvorgaben hinausgehende Emissions- und Immissionsbegrenzung. Selbst wenn eine drittschützende Wirkung im Vorsorgebereich anzunehmen wäre, müsste der Behörde bei der Ermittlung und Bewertung der Risiken auf der Grundlage technischen oder naturwissenschaftlichen Sachverstands eine Einschätzungsprärogative zuerkannt werden, die die gerichtliche Kontrolle auf die Prüfung beschränke, ob die behördliche Entscheidung auf ausreichenden Ermittlungen und willkürfreien Annahmen beruhe. Nach diesem Maßstab seien Risikoermittlung und -bewertung des Beklagten nicht zu beanstanden.
Gegen das Urteil richtet sich die vom Verwaltungsgerichtshof zugelassene Revision des Klägers, mit der er beantragt, unter Änderung der vorinstanzlichen Urteile die immissionsschutzrechtliche Genehmigung in der Gestalt der Änderungsanzeigen der Beigeladenen und den Widerspruchsbescheid aufzuheben, hilfsweise den Beklagten zu bestimmten Schutzmaßnahmen zu verpflichten, sowie festzustellen, dass sich der Rechtsstreit nach Maßgabe der von der Beigeladenen angezeigten Beschränkung des Emissionsgrenzwerts für Nanopartikel erledigt hat. Der Kläger rügt mehrere Verfahrensfehler und führt zur Begründung in der Sache aus: Die völlig neuartige Nanotechnologie begründe schwer übersehbare und besonders hohe Gesundheitsrisiken, deren Zumutbarkeit die Zulassung durch ein bereichsspezifisches Gesetz voraussetze. Die immissionsschutzrechtliche Schutzpflicht sei verletzt, weil der Verwaltungsgerichtshof im Rahmen der Irrelevanzbetrachtung verkannt habe, dass die potentiell gesundheitsschädliche Wirkung von Nanopartikeln sowohl in Bezug auf ihre Oberflächenstruktur als auch hinsichtlich der Toxizität ihrer Inhaltsstoffe jeweils mit dem Faktor 100 anzusetzen sei. Da mit den verfügbaren Messtechniken 80 % der tatsächlich emittierten Nanopartikel nicht erfasst werden könnten, habe der Verwaltungsgerichtshof den maßgeblichen Immissionswert um den Faktor 5 zu niedrig beurteilt. Aus demselben Grund sei es unmöglich zu prüfen, ob dem Minimierungsgebot Rechnung getragen sei. Zu Unrecht gehe der Verwaltungsgerichtshof davon aus, dass die Immissionszusatzbelastung zum Nachteil des Klägers unabhängig davon sei, ob er 150 m oder nur 75 m von der Anlage entfernt wohne. Bundesrechtswidrig seien die Annahmen, dass der Vorsorgegrundsatz gegenüber dem Kläger keine Schutzwirkung entfalte und, falls dies gleichwohl der Fall sei, der Behörde ein gerichtlich nicht überprüfbarer Beurteilungsspielraum zustehe.
Der Beklagte und die Beigeladene treten der Revision entgegen.
II
Die Revision ist unbegründet. Das angegriffene Urteil beruht nicht auf einer Verletzung von Bundesrecht. Zu Recht hat der Verwaltungsgerichtshof angenommen, dass der Kläger durch die angefochtene Genehmigung in der Gestalt der bestätigten Änderungsanzeigen nicht in seinen Rechten verletzt wird und demgemäß auch keine verstärkten Schutzmaßnahmen beanspruchen kann (1). Zutreffend ist auch die Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs, dass sich der Rechtsstreit durch die Herabsetzung des Emissionsgrenzwerts für Nanopartikel auf 0,5 μg/m³ nicht teilweise erledigt hat (2). Soweit im Übrigen von der Revision geltend gemachte Verfahrensfehler vorliegen, kann das angegriffene Urteil nicht auf ihnen beruhen (3).
1. Der Kläger befürchtet eine Beeinträchtigung seiner Gesundheit durch die von der genehmigten Anlage ausgehenden Nanopartikel. Gegenüber diesem Gefährdungspotential beansprucht er Schutz, den er durch die angegriffene Genehmigung nicht hinreichend gewährleistet sieht. Prüfungsmaßstab hierfür ist das Bundes-Immis-sionsschutzgesetz, das zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen die Pflichten der Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen regelt, die durch untergesetzliche Vorschriften, insbesondere die TA Luft, konkretisiert werden. Diese auf die Anlage der Beigeladenen anwendbaren Vorschriften bieten ausreichenden Schutz vor den von ihr ausgehenden Gefahren und beugen durch Vorsorgeanforderungen gegenwärtig noch nicht erkennbaren Risiken möglicherweise schädlicher Umwelteinwirkungen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit vor. Da die Vorschriften damit geeignet sind, den gebotenen Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt sicherzustellen, bedarf es keiner ausdrücklichen Zulassung von Anlagen zur Herstellung von Nanopulver durch ein bereichsspezifisches Gesetz.
a) Nach § 5 BImSchG in der hier anzuwendenden, bei der letzten Behördenentscheidung maßgeblichen Fassung (vgl. Beschluss vom 11. Januar 1991 - BVerwG 7 B 102.90 - Buchholz 406.25 § 4 BImSchG Nr. 5) sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können (Nr. 1) und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung (Nr. 2). Der im Einwirkungsbereich der Anlage wohnende Dritte kann eine dem Betreiber erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung mittels des ihm in § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG eingeräumten Schutz- und Abwehrrechts anfechten. Eine derart drittschützende Wirkung der Vorsorgepflicht (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG) hat das Bundesverwaltungsgericht verneint, weil diese Regelung nicht der Begünstigung eines individualisierbaren Personkreises, sondern dem Interesse der Allgemeinheit daran dient, potentiell schädlichen Umwelteinwirkungen generell und auch dort vorzubeugen, wo sie keinem bestimmten Emittenten zuzuordnen sind (vgl. BVerwGE 65, 313 <320>; BVerwGE 69, 37 <42 ff.>). Daran hält der Senat fest.
Die immissionsschutzrechtliche Schutzpflicht als Instrument der Gefahrenabwehr greift ein, wenn die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts besteht. Sie dient der Abwehr erkannter Gefahren und der Vorbeugung gegenüber künftigen Schäden, die durch solche Gefahren hervorgerufen werden können. Ob Umwelteinwirkungen im Einzelfall geeignet sind, Gefahren herbeizuführen, unterliegt der verwaltungsgerichtlichen Prüfung (BVerwGE 55, 250 <253>). Eine Gefahr liegt nach der klassischen Begriffsdefinition dort vor, wo "aus gewissen gegenwärtigen Zuständen nach dem Gesetz der Kausalität gewisse andere Schaden bringende Zustände und Ereignisse erwachsen werden" (PrOVG, Urteil vom 15. Oktober 1894, PrVBl 16, 125 <126>). Daran fehlt es bei Ungewissheit über einen Schadenseintritt. Potentiell schädliche Umwelteinwirkungen, ein nur möglicher Zusammenhang zwischen Emissionen und Schadenseintritt oder ein generelles Besorgnispotential können Anlass für Vorsorgemaßnahmen sein, sofern diese nach Art und Umfang verhältnismäßig sind. Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen erfasst mithin mögliche Schäden, die sich deshalb nicht ausschließen lassen, weil nach dem derzeitigen Wissensstand bestimmte Ursachenzusammenhänge weder bejaht noch verneint werden können, weshalb noch keine Gefahr, sondern nur ein Gefahrenverdacht oder ein Besorgnispotential besteht (BVerwGE 72, 300 <315>). Gibt es hinreichende Gründe für die Annahme, dass Immissionen möglicherweise zu schädlichen Umwelteinwirkungen führen, ist es Aufgabe der Vorsorge, solche Risiken unterhalb der Gefahrengrenze zu minimieren (vgl. BVerwGE 69, 37 <43, 45>; Beschluss vom 30. August 1996 - BVerwG 7 VR 2.96 - Buchholz 406.25 § 17 BImSchG Nr. 3).
Ob bei ungewissem Kausalzusammenhang zwischen Umwelteinwirkungen und Schäden eine Gefahr oder ein Besorgnispotential anzunehmen ist, hängt vom Erkenntnisstand über den Wahrscheinlichkeitsgrad des Schadenseintritts ab. Die Grenze zwischen drittschützender Schutzpflicht und gefahrenunabhängiger Risikovorsorge bei Ungewissheit über die Schädlichkeit von Umweltauswirkungen für die menschliche Gesundheit ist bisher nicht für alle Schadstoffe in einem Verfahren nach § 48 BImSchG festgelegt worden, das das hinzunehmende Risiko für den Einzelnen und für die Allgemeinheit aufgrund fachlichen Sachverstands, politischer Legitimation und verantwortbarer Bewertung konkretisiert. Bei potentiell gesundheitsgefährdenden Stoffen, für die nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen keine Wirkungsschwelle bestimmt werden kann, jenseits derer Gesundheitsrisiken nicht bestehen, begnügt sich die TA Luft in der hier anzuwendenden Fassung vom 27. Februar 1986 (GMBl S. 95, ber. S. 202) damit, den erforderlichen Schutz der menschlichen Gesundheit durch die Verpflichtung des Anlagenbetreibers sicherzustellen, Emissionen solcher Stoffe unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit so weit wie möglich zu begrenzen (vgl. Nr. 2.3 Abs. 1 und Nr. 3.1.7 Abs. 7 TA Luft.
Solange auf der Grundlage des § 48 BImSchG keine Immissionswerte bestimmt worden sind, dienen solche Minimierungsgebote nicht nur der allgemeinen Verbesserung der Umweltverhältnisse, sondern auch dem Schutz eines individualisierbaren Personenkreises im Einwirkungsbereich der Anlage. Unter diesen Voraussetzungen kann der Betroffene mit Rechtsmitteln gegen die Genehmigung geltend machen, dass im Rahmen des Vorsorgegebots erlassene Emissionsgrenzwerte zur Minimierung seines Gesundheitsrisikos eingehalten werden. Gegenüber dem Minimierungsgebot findet die Schutzpflicht allerdings dort ihre Grenze, wo aufgrund einer sachverständigen Risikoabschätzung anzunehmen ist, dass das durch den emittierenden Betrieb verursachte Gesundheitsrisiko angesichts der bestehenden Vorbelastung irrelevant ist. Bei einer am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten Bewertung ist es gerechtfertigt, in Anlehnung an den in Nr. 2.6.1.1 Satz 5 TA Luft zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken, dass bei der Ermittlung der Immissionskenngrößen Massenströme unterhalb einer bestimmten Grenze ohne weitere Prüfung vernachlässigbar sind, auch für Immissionsbeiträge eine Bagatellgrenze anzuerkennen, bei deren Unterschreiten eine weitere Begrenzung der Emissionen regelmäßig entbehrlich ist. Als in diesem Sinne irrelevant anzusehen ist eine Immissionszusatzbelastung unter 1 % anerkannter Wirkungsschwellen (vgl. Länderausschuss für Immissionsschutz <LAI>, Bewertung von Schadstoffen, für die keine Immissionswerte festgelegt sind, hrsg. vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 1990, S. 26 f.). Fehlt es an naturwissenschaftlich feststellbaren Wirkungsschwellen, ist es frei von Willkür, wenn der Irrelevanzbetrachtung mangels besserer Erkenntnis die in der LAI-Studie "Krebsrisiko durch Luftverunreinigungen" (1991) entwickelten Beurteilungsmaßstäbe für kanzerogene Wirkungen vergleichbarer Stoffe als Orientierungswerte zugrunde gelegt werden. Jenseits einer solchen Irrelevanzgrenze, die den Bereich des unausweichlichen Restrisikos markiert, ist die immissionsschutzrechtliche Schutz- und Abwehrpflicht gegenstandslos.
b) Der Verwaltungsgerichtshof hat aufgrund der vom Beklagten eingeholten Stellungnahmen, des vom Verwaltungsgericht zur Überprüfung der behördlichen Risikoabschätzung erhobenen Sachverständigengutachtens (Prof. Dr. G.) und der Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. W. die Überzeugung gewonnen, dass das dem Kläger durch den Betrieb der Nanopulveranlage zugemutete Gesundheitsrisiko vernachlässigbar gering sei. Unter dem Aspekt möglicher Gesundheitsrisiken ist der Verwaltungsgerichtshof davon ausgegangen, dass die auf der Grundlage der Messung des Instituts für Umwelttechnologie und Umweltanalytik (IUTA) an der Universität Duisburg vom 6. Mai 1996 und des Berichts der TÜV Gesellschaft für Analytik und Messtechnik im Umweltschutz (AMU) vom 18. Juni 1997 vorgenommene, in der Stellungnahme der Landesanstalt für Umweltschutz vom 27. August 1997 dargelegte Immissionsprognose beim Kläger zu einer maximalen Zusatzbelastung durch Nanostaubimmissionen in Höhe von 0,003 ng/m³ (Punktwert) führe, die im Rahmen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG als unerheblich angesehen werden könne, weil sie in Bezug auf den als Hilfsparameter heranzuziehenden LAI-Beurteilungs-maßstab für Dieselruß (1,5 μg/m³) das bei 15 ng/m³ liegende Irrelevanzkriterium 5 000fach und bei Berücksichtigung eines zusätzlichen Sicherheitsfaktors von zwei Zehnerpotenzen immer noch 50fach unterschreite. Bei Verschärfung des LAI-Beurteilungsmaßstabs für Dieselruß um diesen Sicherheitszuschlag sei der Kläger vor Gesundheitsrisiken hinreichend geschützt. Nanopartikel wirkten vorrangig nicht kanzerogen auf die Atmungswege und den Herz-Kreislauf-Bereich. Die Hypothese ihrer Weiterverbreitung durch das Blut zu anderen Körperorganen sei wissenschaftlich nicht gesichert. Da kanzerogene Wirkungen von Nanopartikeln nicht ausgeschlossen werden könnten, sei die Orientierung an dem wissenschaftlich erforschten Beurteilungsmaßstab für kanzerogene Dieselrußpartikel ungeachtet deren anderer stofflicher Zusammensetzung eine sachgerechte Hilfskonstruktion. Wegen des im Einzelnen noch nicht erkennbaren Risikos, das von Inhaltsstoffen der Nanopartikel ausgehen könne, reiche der Sicherheitszuschlag von zwei Zehnerpotenzen aus.
Diese Risikoabschätzung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die sachverständig ermittelte Zusatzbelastung, mit der der Kläger als Nachbar der emittierenden Anlage im ungünstigsten Fall zu rechnen hat, liegt deutlich unterhalb der Irrelevanzgrenze. Da nach der LAI-Studie "Krebsrisiko durch Luftverunreinigungen" mit einer mittleren Vorbelastung an Dieselrußpartikeln von 7,2 μg/m³ in Ballungsgebieten und von 0,9 μg/m³ in ländlichen Gebieten zu rechnen ist (a.a.O., S. 126), ist die von der Anlage der Beigeladenen hervorgerufene maximale Nanostaubimmission von 0,003 ng/m³ unter dem Aspekt eines möglichen Gesundheitsrisikos des Klägers vernachlässigbar.
Die Verfahrensrüge der Revision, dass bei der Irrelevanzbetrachtung ein Sicherheitszuschlag von vier Zehnerpotenzen hätte berücksichtigt werden müssen, ist unbegründet. Der vom Verwaltungsgerichtshof angehörte Sachverständige Prof. Dr. W. hat nicht die ihm von der Revision unterlegte Auffassung vertreten, dass die stoffliche Zusammensetzung der Nanopartikel zu vernachlässigen sei und der Sicherheitszuschlag von zwei Zehnerpotenzen allein dazu diene, der stärkeren Oberflächenwirksamkeit ultrafeiner Nanopartikel gegenüber den (lediglich) feinen Dieselrußpartikeln Rechnung zu tragen. Der Sachverständige hat den für kanzerogene Wirkungen entwickelten Beurteilungsmaßstab für Dieselrußpartikel als Ausgangspunkt einer geeigneten Hilfskonstruktion angesehen, da dieser Wert sozusagen das "Nadelöhr" für alle Betrachtungen sei, und die Relevanz unterschiedlicher Toxizität der Inhaltsstoffe von Nanopartikeln oder der an deren Oberfläche angelagerten Stoffe bei konservativer Bewertung mit dem Faktor 100 berücksichtigt. Er hat damit den im Vergleich zu anderen Feinstäuben (PM/10 und PM/2,5) ohnedies deutlich niedrigeren, konservativ festgelegten LAI-Beurteilungsmaßstab für Dieselrußpartikel mit Rücksicht auf die mögliche Toxizität von Inhaltsstoffen auf 15 ng/m³ verschärft und diesen Wert als "derzeit bestmöglichen Weg" bezeichnet, um Gesundheitsrisiken durch in Massenkonzentration ausgedrückte Immissionen schadstoffbelasteter Nanopartikel nach dem Maßstab praktischer Vernunft auszuschließen. Angesichts dessen beruht die vom Verwaltungsgerichtshof angenommene Irrelevanz der Zusatzbelastung weder auf verfahrensfehlerhaften Ermittlungen noch auf einer willkürlichen Bewertung der Gesundheitsrisiken.
Ebenfalls zu Unrecht hält die Revision die Annahme des Verwaltungsgerichtshofs für verfahrensfehlerhaft, das aufgrund einer herkömmlichen Ausbreitungsrechnung in einer Entfernung von etwa 200 - 300 m von der Emissionsquelle ermittelte, der Irrelevanzbetrachtung zugrunde gelegte Immissionsmaximum würde sich nicht zu Lasten des Klägers erhöhen, wenn die spezielle Ausbreitungsart von Nanopartikeln berücksichtigt und davon ausgegangen werde, dass das Wohnhaus des Klägers anstatt 150 m nur 75 m von der Emissionsquelle entfernt sei. Der Verwaltungsgerichtshof hat zutreffend erkannt, dass bei Berücksichtigung der durch Anlagerung an andere Nanopartikel oder sonstige Schwebstoffe rasch zunehmenden Größe der emittierten Nanopartikel einerseits das Immissionsmaximum an die Emissionsquelle heranrückt und andererseits die Anzahl der immittierten Nanopartikel aufgrund der Anlagerung abnimmt. Der hieraus von ihm gezogene Schluss, dass sich die Vor- und Nachteile einer Ausbreitungsrechnung, die das Anwachsen der Nanopartikel durch Anlagerung einbeziehe, gegenüber einer herkömmlichen Ausbreitungsrechnung, die mangels Berücksichtigung des spezifischen Verhaltens von Nanopartikeln unmittelbar nach ihrer Emission regelmäßig zu einer Überschätzung ihrer Anzahlkonzentration führe, in Bezug auf die Immissionszusatzbelastung des Klägers im Wesentlichen kompensierten, verstößt nicht gegen die Denkgesetze. Die Revision gelangt zu einer unverminderten Anzahl immittierter Nanopartikel deshalb, weil sie eine Anlagerung von Nanopartikeln an andere Nanopartikel ausschließt. Diese Annahme ist spekulativ und steht im Gegensatz zu den vom Verwaltungsgerichtshof zugrunde gelegten Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. W..
c) Der Verwaltungsgerichtshof hat die von der Anlage der Beigeladenen verursachte Zusatzbelastung des Klägers durch Nanopartikelimmissionen zu Recht nicht anhand der tatsächlich gemessenen Emissionen, sondern auf der Grundlage des genehmigten Massenkonzentrationsgrenzwerts von 0,5 μg/m³ ermittelt. Bei der Beurteilung, ob die Beigeladene als Betreiberin der Anlage die ihr gegenüber dem Kläger obliegende Schutzpflicht erfüllt, ist davon auszugehen, dass sie Schadstoffe bis zu dem festgesetzten Grenzwert emittieren darf. Infolgedessen ist die an den genehmigten Grenzwert anknüpfende Emissionsdatenbasis als der Wert anzusehen, der sich im Sinne der Nr. 3 des Anhangs C der TA Luft beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage ergibt. Dieser Wert muss daher auch Grundlage der Ausbreitungsrechnung sein. Die Vorschriften über die Ermittlung des Emissionsmassenstroms sind bei einem bereits festgelegten Emissionsgrenzwert nur insoweit von Bedeutung, als es um die Kontrolle seiner Einhaltung geht. Kann der genehmigte Wert nicht eingehalten werden, ist die immissionsschutzrechtliche Genehmigung rechtswidrig. Ob dies der Fall ist, ist entgegen der missverständlichen Formulierung des Verwaltungsgerichtshofs nicht nach dem Maßstab der Offensichtlichkeit, sondern danach zu beurteilen, ob die Prognose, die Anlage werde im bestimmungsgemäßen Betrieb den festgelegten Grenzwert einhalten, vertretbar ist. Diese Frage muss mit Blick auf die hier vorgenommenen Messungen sachverständiger Institute bejaht werden:
Nach der Genehmigung in der Gestalt der Änderungsanzeigen der Beigeladenen vom 14. August 2001 dürfen die in dem auf 17,5 g/h begrenzten Gesamtstaubmassenstrom enthaltenen Nanopartikel eine Massenkonzentration von 0,5 μg/m³ nicht überschreiten. Der im Gerichtsverfahren überprüften Risikoabschätzung aufgrund der Immissionsprognose der Landesanstalt für Umweltschutz und der an sie anschließenden Berechnungen der Sachverständigen Prof. Dr. G. und Prof. Dr. W. lag übereinstimmend eine durch Messungen von IUTA und AMU TÜV ermittelte Massenkonzentration von weniger als 0,5 μg/m³ Nanopartikeln bei einer Gesamtstaubemission von kleiner als 1 mg/m³ bzw. 0,2 mg/m³ zugrunde. Der Kläger hat die Geeignetheit der Messungen in Zweifel gezogen und die Einholung eines Sachverständigengutachtens zum Beweis der Tatsache beantragt, dass die von
IUTA und AMU TÜV angewandte Messtechnik des rasterelektronischen Verfahrens ungeeignet sei, weil sie 80 % der emittierten Nanopartikel nicht erfasse. Diesem nach Schluss der mündlichen Verhandlung und nach Ablauf der eingeräumten Schriftsatzfrist gestellten Beweisantrag ist der Verwaltungsgerichtshof verfahrensfehlerfrei nicht nachgegangen, weil es auf die unter Beweis gestellte Tatsache aus seiner rechtlichen Sicht nicht ankam. Denn auch bei Unterstellung dieser Behauptung als wahr wird die beim LAI-Beurteilungsmaßstab für Dieselruß mit 15 ng/m³ anzunehmende Irrelevanzgrenze unter Berücksichtigung des Sicherheitszuschlags von zwei Zehnerpotenzen für nach dem Stand der Erkenntnis nicht auszuschließende Gesundheitsrisiken durch Nanopartikel deutlich unterschritten. Das ergibt sich aus den im Berufungsverfahren vom Beklagten vorgelegten Ergebnissen der Messung der TÜV Ecoplan Umwelt GmbH vom 12. Juli 2000, bei der für Nanopartikel eine Massenkonzentration von 0,0067 μg/m³ ermittelt wurde, die bei einer Erhöhung um den vom Kläger behaupteten Ungenauigkeitsfaktor 5 auf 0,0335 μg/m³ immer noch um eine Größenordnung unter dem festgesetzten Emissionsgrenzwert von 0,5 μg/m³ läge. Dabei bleibt zu Gunsten des Klägers unberücksichtigt, dass nach Auffassung des Sachverständigen Prof. Dr. W. ein an der Massenkonzentration orientierter Grenzwert bei Umrechnung in die Anzahlkonzentration eher zu einer Überschätzung der Immissionen führt, weil schon wenige größere Partikel die Masse erhöhen, die nach dem Stand der Wissenschaft für Gesundheitsrisiken durch Nanopartikel weniger von Belang ist als deren Anzahl und Oberflächenwirksamkeit.
2. Zu Recht hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die Herabsetzung des im Genehmigungsbescheid festgesetzten Emissionsgrenzwerts für Nanopartikel von 50 μg/m³ auf den Wert von 0,5 μg/m³ keine (Teil-)Erledigung des Rechtsstreits bewirkt hat. Das folgt daraus, dass die Genehmigung durch die behördliche Änderungsbestätigung ersetzt wurde und der Kläger seine Klage gegen den in der Änderungsbestätigung zu sehenden geänderten Verwaltungsakt fortgeführt hat. Die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache setzt voraus, dass ein nach der Klageerhebung eingetretenes außerprozessuales Ereignis dem Klagebegehren die Grundlage entzogen hat (BVerwGE 87, 62 <64 f.>). Die Änderung des Emissionsgrenzwerts hat das Rechtsschutzziel des Klägers nicht, auch nicht teilweise, gegenstandslos gemacht. Sie hat zu einer Änderung der Klage geführt, die sich nunmehr auf die Genehmigung in der Gestalt des geänderten Emissionsgrenzwerts erstreckt. Wird im Lauf des Prozesses ein angefochtener Verwaltungsakt durch einen neuen ersetzt, kann der Kläger allerdings die Rechtswidrigkeit des auf diese Weise erledigten Verwaltungsakts feststellen lassen, wenn er an der Feststellung ein berechtigtes Interesse hat. Einen solchen Antrag hat der Kläger nicht gestellt.
3. Soweit die von der Revision im Übrigen gerügten Verfahrensfehler vorliegen, kann das angegriffene Urteil nicht auf ihnen beruhen. Der Verwaltungsgerichtshof hat gegen § 116 Abs. 2 VwGO verstoßen, der vorschreibt, dass bei verkündungsersetzender Zustellung das Urteil binnen zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung der Geschäftsstelle zu übergeben ist. Die Frist wurde zwar nicht vor Ende der sechswöchigen Schriftsatzfrist in Lauf gesetzt, die der Verwaltungsgerichtshof dem Kläger eingeräumt hatte (§ 173 VwGO i.V.m. § 283 Satz 1 ZPO), aber gleichwohl um neun Tage überschritten, wenn der Ablauf der Schriftsatzfrist mit dem Schluss der mündlichen Verhandlung gleichgesetzt wird. Dieser Verfahrensfehler hat sich auf das Urteil deswegen nicht ausgewirkt, weil keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass den Richtern der unmittelbare Eindruck von der mündlichen Verhandlung nicht mehr gegenwärtig war. Der Verwaltungsgerichtshof hatte die Anhörung des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung auf Tonband aufzeichnen lassen und die schriftliche Übertragung der Tonbandaufnahme zu den Akten genommen. Damit war sichergestellt, dass die mit zunehmendem Zeitablauf nachlassende Erinnerung an die Einzelheiten der Beweisaufnahme die Überzeugungsbildung der Richter nicht beeinträchtigen konnte. Auch aus dem Revisionsvorbringen ergibt sich nicht, dass das angegriffene Urteil dem Gesamtergebnis des Verfahrens und der in der mündlichen Verhandlung gewonnenen Überzeugung der Richter nicht entspricht. Angesichts dessen bedarf es keiner Entscheidung, unter welchen Voraussetzungen der notwendige Zusammenhang zwischen mündlicher Verhandlung und Urteil durch Einräumung einer Schriftsatzfrist derart gelöst wird, dass das Mündlichkeitsprinzip und damit zugleich der Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör im Zeitpunkt der Urteilsfällung nicht mehr gewährleistet ist (vgl. hierzu BVerwGE 106, 366 <367 f.>).
Ebenso wenig beruht das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs darauf, dass ein Beschluss darüber, ob das Urteil verkündet oder statt der Verkündung zugestellt werde, offenbar nicht verkündet worden ist. Der Prozessbevollmächtigte des Klägers musste nach Ablauf der Schriftsatzfrist mit einer bevorstehenden Entscheidung in der Sache sowie aufgrund des Hinweises des Vorsitzenden am Schluss der mündlichen Verhandlung damit rechnen, dass der Verwaltungsgerichtshof über den verspätet gestellten Beweisantrag nicht durch Beschluss entscheiden würde. Auch ein Recht auf Verkündung des Urteils anstatt seiner Zustellung besteht nicht. Den Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 EMRK an die Öffentlichkeit einer Urteilsverkündung ist entgegen dem nicht näher begründeten Revisionsvorbringen genügt (vgl. EGMR, EuGRZ 1985, 548 <550>). Der Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör ist endlich nicht dadurch verletzt, dass der Verwaltungsgerichtshof die Schriftsatzfrist auf seinen vor deren Ablauf gestellten Antrag nicht verlängert hat. Der Kläger hatte ausreichend Gelegenheit, sich zur Sache und zum Ergebnis der Beweisaufnahme zu äußern. Das Ergebnis der Anhörung des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung konnte ihn nicht unvorbereitet treffen, da es im Wesentlichen Fragen der Risikoabschätzung betraf, die bereits Gegenstand des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht waren. Dabei hat der Verwaltungsgerichtshof nicht nur das Vorbringen des Klägers in dem fristgerecht nachgereichten Schriftsatz, sondern auch jenes im verspäteten Schriftsatz zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung jedoch aus den in den Gründen seiner Entscheidung im Einzelnen dargelegten Erwägungen ermessensfehlerfrei abgelehnt.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 und § 162 Abs. 3 VwGO.
Gödel Kley Herbert