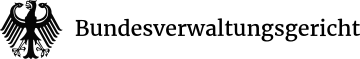Urteil vom 19.05.2005 -
BVerwG 3 C 17.04ECLI:DE:BVerwG:2005:190505U3C17.04.0
Leitsatz:
Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb von Cannabis zur Behandlung einer Multiple-Sklerose-Erkrankung beim Antragsteller kann nicht nach § 3 Abs. 2 BtMG mit der Begründung abgelehnt werden, eine solche Behandlung liege nicht im öffentlichen Interesse.
Urteil
BVerwG 3 C 17.04
- VG Köln - 19.04.2004 - AZ: VG 7 K 1979/01
In der Verwaltungsstreitsache hat der 3. Senat des Bundesverwaltungsgerichts
am 19. Mai 2005
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht
Prof. Dr. D r i e h a u s sowie die Richter am Bundesverwaltungsgericht
van S c h e w i c k , Dr. D e t t e , L i e b l e r und Prof. Dr. R e n n e r t
ohne mündliche Verhandlung für Recht erkannt:
- Das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom 17. Februar 2004 wird geändert. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides vom 4. August 2000 und des undatierten Widerspruchsbescheides des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte verpflichtet, über den Antrag des Klägers auf Erlaubnis zum Erwerb von Cannabis zu medizinischen Zwecken erneut zu entscheiden. Im Übrigen wird die Revision zurückgewiesen.
- Die Beklagte trägt drei Viertel, der Kläger ein Viertel der Kosten des Rechtsstreits.
I
Der Kläger, ein 56-jähriger Rechtsanwalt, leidet unter Multipler Sklerose. Nach eigenen Angaben lebt er inzwischen in einem Heim für schwer Körperbehinderte.
Unter dem 19. Februar 2000 beantragte der Kläger, ihm eine Erlaubnis nach § 3 Betäubungsmittelgesetz - BtMG - zum Besitz und zur Anwendung von Cannabis "zur versuchsweisen Therapie" seiner Erkrankung zu erteilen. Er wies darauf hin, dass seine Krankheit sich hauptsächlich in Muskelspasmen äußere, die ihn an den Rollstuhl fesselten, sowie in Beeinträchtigungen der Seh- und Sprachnerven. Außerdem betonte er, dass es ihm um die Anwendung von Cannabis gehe und er die Anwendung des Ersatzstoffs Dronabinol ablehne, weil der Hauptwirkstoff des Cannabis, Tetrahydrocannabinol (THC), nach vielfältiger Erfahrung nur im Zusammenhang mit anderen Bestandteilen der Pflanze seine heilende und lindernde Wirkung bei Multipler Sklerose entfalte.
Mit Bescheid vom 3. August 2000 lehnte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den Antrag mit der Begründung ab, Cannabis gehöre nach § 1 Abs. 1 BtMG i.V.m. Anlage I dieses Gesetzes zu den nicht verkehrsfähigen Betäubungsmitteln. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmeerlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMB lägen nicht vor. Die erstrebte Behandlung eines einzelnen Patienten sei kein wissenschaftlicher Zweck im Sinne dieser Vorschrift. Auch ein anderer im öffentlichen Interesse liegender Zweck sei nicht gegeben. Zwar könne auch die notwendige medizinische Versorgung eines einzelnen Patienten einen öffentlichen Zweck darstellen; die Anwendung von Cannabis sei aber nicht notwendig, da THC in der Form des Dronabinol nach den vorliegenden medizinischen Erkenntnissen bei der Behandlung von Multipler Sklerose keine geringeren Wirkungen zeige als Cannabis. Außerdem liege der Versagungsgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 BtMG vor, da die Sicherheit oder Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in diesem Fall nicht gewährleistet sei. Durch die Einschaltung eines Arztes könne die erforderliche Sicherheit und Kontrolle nicht gewährleistet werden, da § 13 Abs. 1 Satz 3 BtMG die Verschreibung der in Anlage I des Gesetzes aufgeführten Betäubungsmittel verbiete. Eine Abgabe ohne ärztliche Verschreibung stünde im Widerspruch zu Art. 30 Abs. 2 Buchst. b des Einheits-Übereinkommens von 1961 über Suchtstoffe (BGBl II vom 11. Februar 1977 S. 111), wonach die Vertragsstaaten für die Lieferung oder Abgabe von Suchtstoffen (darunter Cannabis) an Einzelpersonen ärztliche Verordnungen vorzuschreiben hätten. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass der Kläger auch mit einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG Cannabis nicht erwerben könne, da dieser Stoff auf dem deutschen Markt legal nicht zu erwerben sei. Den Widerspruch des Klägers wies das Bundesinstitut durch undatierten Bescheid, beim Kläger eingegangen am 14. Februar 2001, zurück.
Mit seiner Klage auf Erteilung der Erlaubnis zum Erwerb von Cannabis zu medizinischen Zwecken hat der Kläger vorgetragen, das Selbstbestimmungsrecht und die personale Würde des Patienten geböten es, seine Entscheidung für eine bestimmte Therapie und Selbstmedikation zu akzeptieren. Einem Erkrankten müsse die Möglichkeit verbleiben, auch eine Außenseitermethode anzuwenden, um eine Linderung seiner Leiden zu erreichen. Dies solle hier in einem ärztlich überwachten Versuch geschehen. Der Verweis auf den Ersatzstoff Dronabinol trage schon deshalb nicht, weil keine Vergleichsergebnisse zwischen dem synthetisch hergestellten Ersatzstoff und dem natürlichen Produkt Cannabis vorlägen. Der Kläger selbst lehne die Anwendung von Dronabinol ab, nachdem er es eine Zeitlang ausprobiert habe. Das Mittel sei extrem teuer, mindere aber weder die Spastik in nötiger Weise noch ergäben sich sonstige positive Effekte. Dagegen ergebe sich aus den vorgelegten Berichten über die Anwendung von Cannabis, dass die Schmerzen positiv beeinflusst würden und bei fast allen auch eine Spastizitätslinderung auftrete.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, die Versorgung eines einzelnen Patienten mit Betäubungsmitteln sei kein im öffentlichen Interesse liegender Zweck im Sinne des § 3 Abs. 2 BtMG. Der Antrag einer Privatperson sei daher von vornherein nicht erlaubnisfähig. Im Übrigen sei die erfolgte Ablehnung auch ermessensgerecht, weil aus medizinischer Sicht nicht davon ausgegangen werden könne, dass THC (Dronabinol) bei Multipler Sklerose weniger Effekte zeige als Cannabis.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage durch Urteil vom 17. Februar 2004 abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Versagung der begehrten Erlaubnis sei rechtmäßig, weil die Ausnahmevoraussetzungen des § 3 Abs. 2 BtMG nicht vorlägen. Die erstrebte Verwendung von Cannabis diene weder wissenschaftlichen noch anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken. Die Anwendung von Cannabis bei einem einzelnen Patienten sei wissenschaftlich unergiebig. Sie diene auch nicht der notwendigen medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Die Therapie einer einzelnen Person diene allein der Gesundheit des jeweiligen Antragstellers und damit einem individuellen, keinem öffentlichen Anliegen. Bestätigt werde dies durch § 13 Abs. 1 BtMG, der die ärztliche Behandlung eines einzelnen Patienten mit Betäubungsmitteln regele. Eine andere Sicht würde die Konzeption des Betäubungsmittelgesetzes unterlaufen, das in den Anlagen I bis III eine Abstufung nach der Gefährlichkeit der Suchtstoffe vornehme. Die Auffassung des Klägers hätte zur Folge, dass er aufgrund einer Erlaubnis des BfArM ohne ärztliche Kontrolle und Begleitung Zugang zu Cannabis erhalten würde, während für die Stoffe der Anlage III diese Begleitung vorgeschrieben sei.
Das Grundrecht des Klägers auf Leben und körperliche Unversehrtheit stehe der Entscheidung nicht entgegen. Der Kläger habe bereits nicht dargelegt und auch nicht durch ärztliche Gutachten nachgewiesen, dass seine Erkrankung nur durch Cannabis geheilt oder gelindert werde, eine Versagung dieses Mittels ihn also in seinen Grundrechten verletze. Die Frage der Wirksamkeit von Cannabis könne indessen offen bleiben, da dem Kläger zumindest mit dem verschreibungsfähigen Wirkstoff Dronabinol eine gleich wirksame Therapiealternative für die Behandlung von Ataxie und Spastik zur Verfügung stehe, wohingegen für die übrigen Symptome der Multiplen Sklerose auch andere Medikamente der Schulmedizin gegeben seien. Die Kammer gehe davon aus, dass die vom Kläger erwünschte und der Cannabispflanze zugeschriebene günstige Wirkung auf seine Krankheit ebenso mit Dronabinol erzielt werden könne. Die vorliegenden Untersuchungen belegten die Gleichwertigkeit der Mittel. Der Kläger habe nicht dargelegt und durch ein ärztliches Gutachten nachgewiesen, dass ein ernsthafter, ärztlich angeleiteter und überwachter Therapieversuch über einen angemessenen Zeitraum mit Dronabinol bei ihm unternommen worden sei.
Gegen dieses Urteil hat der Kläger mit Zustimmung der Beklagten die vom Verwaltungsgericht zugelassene Sprungrevision eingelegt. Dazu trägt er vor, ein Betroffener müsse bei Krankheiten unklarer Genese- und Verlaufsform "experimentieren" können. Dies gelte vor allem, wenn keine Folgelasten für die Allgemeinheit entstünden, dafür aber Kostenersparnisse in großem Umfang möglich seien. Das Medikament Dronabinol sei keinesfalls ein geeignetes Ersatzmittel. Es sei extrem teuer, wirke aber weder hinsichtlich der Schmerzzustände noch, was besonders belastend sei, hinsichtlich der Spastizität.
Die Beklagte hält das angefochtene Urteil für zutreffend. Sie wiederholt und vertieft ihr früheres Vorbringen. Insbesondere hält sie daran fest, dass die Behandlung einer Einzelperson mit einem Betäubungsmittel kein im öffentlichen Interesse liegender Zweck im Sinne des § 3 Abs. 2 BtMG sei. Die Gleichwertigkeit von Cannabis und Dronabinol bei der Behandlung von Multipler Sklerose sei durch das Verwaltungsgericht nach § 137 Abs. 2 VwGO bindend festgestellt. Im Übrigen werde diese Gleichwertigkeit durch die inzwischen vorliegenden medizinischen Untersuchungen bestätigt.
Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht beteiligt sich am Verfahren. In Übereinstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung hält er die Revision für unbegründet. Er teilt insbesondere die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass die Nutzung von Cannabis zum Zweck der Selbsttherapie keinen im öffentlichen Interesse liegenden Zweck im Sinne des § 3 Abs. 2 BtMG erfülle, sondern ausschließlich dem individuellen Interesse des Klägers diene; die Möglichkeiten der Behandlung eines einzelnen Patienten mit Betäubungsmitteln seien abschließend in § 13 Abs. 1 BtMG geregelt. Außerdem legt er eine Übersicht über die Studien zur Wirksamkeit von Dronabinol und natürlichem Cannabis bei verschiedenen Erkrankungen sowie die Antwort der Bundesregierung betreffend den Einsatz von Cannabis-Wirkstoffen in Arzneimitteln (BTDrucks 15/2331) vor.
II
Die Revision des Klägers ist begründet. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, die Beklagte habe den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zum Erwerb von Cannabis zu medizinischen Zwecken zu Recht abgelehnt, verletzt § 3 Abs. 2 des Gesetzes über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1994 (BGBl I S. 358). Das führt zur Änderung des angefochtenen Urteils und zur Verpflichtung der Beklagten, über den Antrag des Klägers erneut zu entscheiden. Das weitergehende Verpflichtungsbegehren bleibt dagegen ohne Erfolg.
Nach § 3 Abs. 2 BtMG kann das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine Erlaubnis zum Erwerb der in Anlage I des Gesetzes bezeichneten Betäubungsmittel nur ausnahmsweise zu wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erteilen. Diese Bestimmung ist einschlägig, weil Cannabis ebenso wie Cannabisharz ausweislich der 15. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung - 15. BtMÄndV - vom 19. Juni 2001 (BGBl I S. 1180) in Anlage I des Betäubungsmittelgesetzes aufgenommen worden ist, die die nicht verkehrsfähigen Betäubungsmittel enthält.
1. Das Verwaltungsgericht hat die Erlaubnisfähigkeit des Cannabiserwerbs durch den Kläger verneint, weil der Erwerb weder zu wissenschaftlichen noch zu anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erfolgen solle. Das ist im Hinblick auf das Fehlen wissenschaftlicher Zwecke nicht zu beanstanden. Wissenschaftliche Tätigkeit ist alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. Als Forschung ist sie geistige Tätigkeit mit dem Ziel, in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen (vgl. BVerfG, Urteil vom 29. Mai 1973 - 1 BvR 424/71 und 325/72 - BVerfGE 35, 79, 113). Zwar hat der Kläger die Erlaubnis zur "versuchsweisen medizinischen Anwendung" von Cannabis beantragt. Der Versuch soll jedoch lediglich der Feststellung dienen, ob die Anwendung von Cannabis in seinem Fall positive therapeutische Auswirkungen auf sein Krankheitsbild hat; eine systematische Versuchsanlage, die zu einer verallgemeinerungsfähigen Aussage über die Wirksamkeit von Cannabis bei Multipler Sklerose führen könnte, ist nicht beabsichtigt.
Fehl geht aber die Ansicht, die Erlaubnis werde auch nicht zu anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken begehrt. Das Verwaltungsgericht meint, dies folge schon daraus, dass die Therapie einer einzelnen Person allein der Gesundheit des jeweiligen Antragstellers und damit einem individuellen, keinem öffentlichen Anliegen diene. Mit dieser begrifflichen Argumentation schließt es generell die Erteilung einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG zur Behandlung einzelner Patienten mit Cannabis aus.
Die Auffassung des Verwaltungsgerichts wird vom Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht geteilt. Sie steht aber im Widerspruch zu einer Kammerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das durch Beschluss vom 20. Januar 2000 - 2 BvR 2382/99 - NJW 2000, 3126 die Verfassungsbeschwerden mehrerer Multiple-Sklerose-Kranker und Hepatitis-Patienten gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht zur Entscheidung angenommen hat, weil die Betroffenen zunächst versuchen müssten, eine Erlaubnis gemäß § 3 Abs. 2 BtMG zu erlangen. Dazu verweist die Kammer auf den in § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG ausgesprochenen Gesetzeszweck, die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung sei danach auch ein öffentlicher Zweck, der im Einzelfall die Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 3 Abs. 2 BtMG rechtfertigen könne.
Die Literatur ist dem Bundesverfassungsgericht einhellig gefolgt. Körner (BtMG, 5. Auflage 2001, § 3 Rn. 56) bezeichnet die Ablehnungspraxis des BfArM gegenüber den 70 Antragstellern, die im Gefolge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einen Erlaubnisantrag gestellt hatten, als bedenklich, da keine ausgewogene Abwägung der Behandlungsinteressen der schwerkranken Antragsteller mit dem Schutzinteresse der Bevölkerung stattfinde. Weber (BtMG, 2. Auflage 2003, § 3 Rn. 112) meint, ein Erlaubnisantrag dürfte in Fällen wie dem vorliegenden überwiegend auf Sympathie stoßen, doch werde nach dem derzeitigen Befund eine Ermessenreduzierung auf null kaum in Betracht kommen. Der Verweis auf Ermessensgesichtspunkte beinhalte, dass das Gesetz nicht zwingend zur Ablehnung derartiger Anträge führt. Auch Lander (bei Hügel/Junge, Deutsches Betäubungsmittelrecht, 8. Auflage 2002, § 3 BtMG Rn. 17) und Joachimski/Haumer (BtMG, 7. Auflage 2002, § 3 Rn. 45) sehen ein öffentliches Interesse bei einer therapeutischen Zielrichtung als gegeben an.
Der Senat folgt dieser Auffassung. Er hat in seinem Urteil vom 21. Dezember 2000 - BVerwG 3 C 20.00 - (BVerwGE 112, 314, 315), in dem es um die Erteilung einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG zum Zwecke der Religionsausübung ging, ausgesprochen, ein öffentliches Interesse sei gegeben, wenn das Vorhaben zumindest auch einem gegenwärtigen Anliegen der Allgemeinheit entspreche. Daran ist festzuhalten. Zu Unrecht verbindet das Verwaltungsgericht diesen Satz aber mit der Behauptung, die Therapie einer einzelnen Person diene allein der Gesundheit des jeweiligen Antragstellers und damit einem individuellen, keinem öffentlichen Anliegen. Diese Bewertung entspricht weder dem Betäubungsmittelgesetz noch dem Grundgesetz.
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG nennt die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung neben der Verhinderung des Betäubungsmittelmissbrauchs als Gesetzeszweck. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist kein globaler Akt, der sich auf eine Masse nicht unterscheidbarer Personen bezieht. Sie realisiert sich vielmehr stets durch die Versorgung einzelner Individuen, die ihrer bedürfen. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung erfasst nie alle Mitglieder der Bevölkerung zugleich, sondern richtet sich an diejenigen, die jeweils ein bestimmtes Krankheitsbild aufweisen.
Nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG hat jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dieser Bestimmung kommt im Wertehorizont des Grundgesetzes eine große Bedeutung zu. Leben und körperliche Unversehrtheit sind in weiten Bereichen elementare Voraussetzung für die Wahrnehmung der übrigen Grundrechtsgewährleistungen. In das Recht auf körperliche Unversehrtheit kann nicht nur dadurch eingegriffen werden, dass staatliche Organe selbst eine Körperverletzung vornehmen oder durch ihr Handeln Schmerzen zufügen. Der Schutzbereich des Grundrechts ist vielmehr auch berührt, wenn der Staat Maßnahmen ergreift, die verhindern, dass eine Krankheit geheilt oder wenigstens gemildert werden kann und wenn dadurch körperliche Leiden ohne Not fortgesetzt und aufrechterhalten werden. Das gilt insbesondere durch die staatliche Unterbindung des Zugangs zu prinzipiell verfügbaren Therapiemethoden zur nicht unwesentlichen Minderung von Leiden (vgl. BVerfG <1. Kammer des 1. Senats>, Beschluss vom 11. August 1999 - 1 BvR 2181/98 - NJW 1999, 3399, 3400 f.; Schulze-Fielitz bei Dreier, GG, 2. Auflage 2004, Art. 2 II. Rn. 48; Murswieck bei Sachs, GG, 3. Auflage 2003, Art. 2 Rn. 159 a).
Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit steht in enger Beziehung zur Menschenwürde, die zu achten und zu schützen nach Art. 1 GG Aufgabe aller staatlichen Gewalt ist. Schwere Krankheit und das Leiden an starken, lange dauernden Schmerzen können den Betroffenen hindern, ein selbstbestimmtes und seinen Vorstellungen von einem menschenwürdigen Leben entsprechendes Leben zu führen. Daraus folgt, dass die Therapierung schwer kranker Menschen nicht nur jeweils deren individuelle Interessen verfolgt, sondern ein Anliegen der Allgemeinheit ist. Der vom Verwaltungsgericht insoweit aufgebaute Gegensatz ist nicht haltbar. Die Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG kann auch für die Therapie eines einzelnen Patienten erteilt werden.
Die Auffassung, die Behandlung eines einzelnen Patienten mit Cannabis könne von vornherein nicht im öffentlichen Interesse liegen, ist auch deshalb nicht nachvollziehbar, weil zwar der konkret zu bescheidende Antrag jeweils von einer Person gestellt ist, dasselbe Anliegen aber häufig von einer größeren Zahl von Patienten geteilt wird. Die Frage des Einsatzes von Cannabis zur Krankheitsbehandlung nimmt seit langem in der öffentlichen Diskussion breiten Raum ein (vgl. BTDrucks 13/3282; BTDrucks 15/2331; Körner, a.a.O., § 3 Rn. 56). Dabei geht es stets um die Frage, ob der mögliche Nutzen eines solchen Therapieeinsatzes die Gefahr eines Betäubungsmittelmissbrauchs ausgleicht oder gar übersteigt. Diesen Fragen kann nicht dadurch ausgewichen werden, dass die Therapierung des einzelnen Patienten ausschließlich zur Privatsache erklärt wird.
2. Zu Unrecht beruft sich das Verwaltungsgericht für seine Auffassung, eine Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG könne nicht zu therapeutischen Zwecken erteilt werden, auch auf § 13 Abs. 1 Satz 3 BtMG. Die Vorschrift verbietet es Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten, die in Anlagen I und II bezeichneten Betäubungsmittel zu verschreiben, zu verabreichen oder einem anderen zum unmittelbaren Verbrauch zu überlassen.
Das Verwaltungsgericht sieht ebenso wie der Vertreter des Bundesinteresses § 13 Abs. 1 BtMG insgesamt als abschließende Regelung für den therapeutischen Einsatz von Betäubungsmitteln an. Daran ist richtig, dass Betäubungsmittel der Anlage I, die unter § 3 Abs. 2 BtMG fallen, nicht nach § 13 Abs. 1 BtMG verschrieben und verabreicht werden dürfen. Das ist in Satz 3 dieser Regelung ausdrücklich ausgesprochen. Dies ist auch konsequent, denn diese Betäubungsmittel sind weder verkehrs- noch verschreibungsfähig. Das besagt aber nichts darüber, ob sie auf anderen Wegen, nämlich mittels einer Erlaubnis nach § 3 BtMG, zur Anwendung kommen können. Dazu trifft § 13 BtMG schon seinem Wortlaut nach keine Aussage (ebenso BVerfG <3. Kammer des 2. Senats>, Beschluss vom 20. Januar 2000 - 2 BvR 2382/99 - a.a.O.). Er regelt in Abs. 1 Satz 1 die therapeutische Verwendung von Betäubungsmitteln der Anlage III. Die dort aufgeführten Stoffe sind verkehrs- und verschreibungsfähig. Satz 3 nimmt von diesem Einsatzweg nicht nur die Mittel der Anlage I sondern auch die der Anlage II aus, die verkehrs- aber nicht verschreibungsfähige Betäubungsmittel enthält. Diese unterliegen nur dem Erlaubnisverfahren nach § 3 Abs. 1 BtMG, für das die Versagungsgründe nach § 5 BtMG maßgeblich sind. Irgendeinen Hinweis, dass insoweit ein Einsatz zu therapeutischen Zwecken unzulässig sein sollte, gibt das Gesetz nicht. Wenn aber das Verbot des § 13 Abs. 1 Satz 3 BtMG für Betäubungsmittel der Anlage II den therapeutischen Einsatz nicht verbietet, ist nicht zu erkennen, wieso dieselbe Vorschrift für Betäubungsmittel der Anlage I einen weitergehenden Gehalt haben sollte.
Das bedeutet, dass eine zu therapeutischen Zwecken erteilte Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG über die Hürde der fehlenden Verkehrsfähigkeit hinweghilft, nicht aber die Verschreibungsfähigkeit herstellt. Ärzte dürfen die in Anlage I aufgeführten Betäubungsmittel in keinem Fall selbst zur Therapie bei einem Patienten einsetzen. Dem steht das Verbot des § 13 Abs. 1 Satz 3 BtMG entgegen. Das hindert sie aber nicht, einen Patienten medizinisch zu betreuen und zu begleiten, der auf der Grundlage einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG solche Mittel im Rahmen der Selbsttherapie bei sich anwendet.
Das angefochtene Urteil beruht hiernach auf einer unrichtigen Auslegung des § 3 Abs. 2 BtMG und damit auf einem Bundesrechtsverstoß.
3. Das angefochtene Urteilt stellt sich nicht aus anderen Gründen im Ergebnis als richtig dar (§ 144 Abs. 4 VwGO). Insoweit könnte allerdings die Aussage des Verwaltungsgerichts relevant sein, dass dem Kläger zumindest mit dem verschreibungsfähigen Wirkstoff Dronabinol eine gleich wirksame Therapiealternative für die Behandlung der im Rahmen der Multiplen Sklerose auftretenden Ataxie (Störung der Koordination von Bewegungsabläufen) und Spastik zur Verfügung stehe, während für die übrigen Symptome der Krankheit auch andere Medikamente der Schulmedizin gegeben seien. Das Verwaltungsgericht verwendet diese Aussage im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 GG, um darzutun, dass die Verweigerung des Cannabiserwerbs keinen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Klägers darstelle. Wäre die Aussage richtig, müsste sie aber schon in die Auslegung des § 3 Abs. 2 BtMG einbezogen werden. Wenn dem Betroffenen zur Behandlung seiner Krankheit ein gleich wirksames zugelassenes Arzneimittel zur Verfügung steht, besteht kein öffentliches Interesse, stattdessen im Wege der Ausnahmeerlaubnis den Einsatz eines weder verkehrs- noch verschreibungsfähigen Betäubungsmittels zuzulassen.
Der Kläger bestreitet mit der Revision wie im gesamten früheren Verfahren, dass Dronabinol bei der Behandlung von Multipler Sklerose die gleichen Wirkungen zeige wie Cannabis. Dronabinol ist die Bezeichnung des synthetisch hergestellten Cannabis-Wirkstoffs Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC), neben dem Cannabis noch eine Reihe weiterer Wirkstoffe enthält (vgl. Körner a.a.O. C 1 Rn. 236). Es wird in den USA hergestellt und ist in Anhang III zum Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Es ist in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen, kann aber nach § 73 Abs. 3 AMG nach Deutschland importiert werden. Die Frage, ob dieses Mittel bei bestimmten schweren Erkrankungen, zu denen neben Multipler Sklerose unter anderem auch Aids gehört, die gleichen Wirkungen entfaltet wie Cannabis, ist sehr umstritten und Gegenstand verschiedener Forschungsarbeiten, wie nicht zuletzt in der Revisionserwiderung der Beklagten dargelegt ist.
Ob die Aussage des Verwaltungsgerichts, Dronabinol sei gleich wirksam wie Cannabis, hinreichend belegt ist, erscheint vor diesem Hintergrund nicht unzweifelhaft. Dennoch kann der Kläger mit seinen dagegen gerichteten Rügen kein Gehör finden. Mit der Sprungrevision können nach § 134 Abs. 4 VwGO Verfahrensmängel nicht gerügt werden. Der Kläger kann also nicht geltend machen, das Verwaltungsgericht habe die Gleichwertigkeit von Dronabinol und Cannabis nicht ausreichend geklärt.
Gleichwohl erweist sich das angefochtene Urteil nicht wegen der Möglichkeit der Verwendung von Dronabinol im Ergebnis als richtig. Dronabinol ist kein zugelassenes Arzneimittel. Deshalb wird es selbst bei ärztlicher Verschreibung nicht von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet. Es ist schwer erhältlich und extrem teuer (vgl. Körner, a.a.O., § 3 Rn. 56; Amtsgericht Mannheim, Urteil vom 15. Mai 2003 - 1 Ls 310 Js 5518/02 -; BTDrucks 15/2331 S. 4 f.).
Diese Aussagen beinhalten keine Korrektur der erstinstanzlichen Tatsachenfeststellungen. Sie machen vielmehr deutlich, dass das Verwaltungsgericht den Begriff der Verfügbarkeit eines gleichwertigen Wirkstoffes falsch ausgelegt hat. Es hat lediglich auf die Erhältlichkeit eines - aus seiner Sicht - gleich wirksamen Stoffes abgestellt. Der Verweis auf ein Arzneimittel, das weder ohne weiteres verfügbar noch für den normalen Bürger erschwinglich ist, stellt aber keine Alternative dar, die das öffentliche Interesse am Einsatz von Cannabis zur Krankheitsbekämpfung entfallen lässt.
4. Das angefochtene Urteil stellt sich nicht deshalb im Ergebnis als richtig dar, weil die therapeutische Wirksamkeit von Cannabis bei Multipler Sklerose - was das Verwaltungsgericht offen gelassen hat - bislang nicht nachgewiesen ist. Zwar sieht sich die Bundesregierung durch den fehlenden Wirksamkeitsnachweis derzeit gehindert, neben Dronabinol auch natürlichen Cannabisextrakt verschreibungsfähig zu machen (BTDrucks 15/2331 S. 6). Abgesehen von der Unschlüssigkeit dieser Argumentation, weil auch für Dronabinol bislang kein Wirksamkeitsnachweis vorliegt (BTDrucks 15/2331 S. 4), kann das für eine Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG erforderliche öffentliche Interesse nicht schon wegen des fehlenden Wirksamkeitsnachweises verneint werden; nur der Nachweis der mangelnden therapeutischen Wirksamkeit steht der Annahme eines öffentlichen Interesses und damit der Erteilung der Erlaubnis zwingend entgegen. Das ergibt sich aus folgenden Überlegungen:
Zieht man die Grundsätze der Arzneimittelzulassung heran, so ist nach § 25 Abs. 2 Nr. 4 AMG ein Arzneimittel nicht zulassungsfähig, dem die vom Antragsteller angegebene therapeutische Wirksamkeit fehlt oder bei dem die Wirksamkeit nach dem jeweils gesicherten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Antragsteller unzureichend begründet ist. Die therapeutische Wirksamkeit ist hiernach Zulassungsvoraussetzung für ein Arzneimittel. Dieser Grundsatz kann aber in das Erlaubnisverfahren nach § 3 Abs. 2 BtMG nicht übertragen werden, weil die Regelungen unterschiedliche Interessenlagen zum Gegenstand haben.
Die Zulassung eines Arzneimittels ist eine generelle Entscheidung, die das Arzneimittel ohne weiteres verkehrsfähig macht. Das Erfordernis der therapeutischen Wirksamkeit hat in diesem Zusammenhang die Schutzfunktion, den Patienten vor der Einnahme unwirksamer Arzneimittel zu bewahren, die ihn unter Umständen von der Anwendung wirksamer Therapiemöglichkeiten abhält. Das Erlaubnisverfahren nach § 3 Abs. 2 BtMG hat dagegen eine gänzlich andere Funktion. Die Entscheidung, einem Patienten den Erwerb oder, was insbesondere bei Cannabis in Betracht kommt, etwa den Anbau zu gestatten, bleibt stets eine Einzelfallentscheidung. Sie muss die konkreten Gefahren des Betäubungsmitteleinsatzes, aber auch dessen möglichen Nutzen in Rechnung stellen. Dieser kann gerade bei schweren Erkrankungen, wie sie hier in Rede stehen, auch in einer Verbesserung des subjektiven Befindens liegen. Dabei ist sich der Betroffene bewusst, dass es keinerlei Gewähr für die therapeutische Wirksamkeit des eingesetzten Betäubungsmittels gibt. Bei schweren Erkrankungen ohne Aussicht auf Heilung gebietet es in diesem Rahmen die von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geforderte Achtung vor der körperlichen Unversehrtheit, die Möglichkeit einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG nur dann auszuschließen, wenn ein therapeutischer Nutzen keinesfalls eintreten kann.
Speziell im Hinblick auf die Benutzung von Cannabis ist hierzu folgendes zu ergänzen: Nach der Feststellung des Bundesverfassungsgerichts sind die von Cannabisprodukten ausgehenden Gesundheitsgefahren aus heutiger Sicht zwar geringer, als der Gesetzgeber bei Erlass des Betäubungsmittelgesetzes angenommen hat, doch verbleiben auch nach dem jetzigen Erkenntnisstand nicht unbeträchtliche Gefahren und Risiken. Diese Gefahren und Risiken rechtfertigen es nach wie vor, den Umgang mit Cannabisprodukten generell unter Strafe zu stellen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 9. März 1994 - 2 BvL 43 u.a./92 - BVerfGE 90, 145, 181 f.) und das Recht des potenziellen Konsumenten auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit durch Cannabisgenuss zurückzudrängen. Die genannten Gefahren und Risiken, die insbesondere beim Umgang von Jugendlichen mit Cannabis drohen, stellen sich aber ganz anders dar, wenn es um den Einsatz des Betäubungsmittels zur Bekämpfung einer Krankheit geht. Hier geht es um ein sehr viel höheres Rechtsgut als die allgemeine Handlungsfreiheit oder das aus ihr von einigen hergeleitete "Recht auf Rausch". In einer solchen Abwägungssituation erscheint die Aufrechterhaltung der Strafbarkeit nur vertretbar, wenn schon die Möglichkeit einer Heilung oder Linderung der schweren Erkrankung die Erlaubnisfähigkeit eröffnet. Außerdem stellt bei schweren Erkrankungen, wie sie hier in Rede stehen, schon die Verbesserung der subjektiven Befindlichkeit eine Linderung dar, deren Eröffnung im öffentlichen Interesse liegt.
5. Die ablehnende Entscheidung des Bundesinstituts ist auch darauf gestützt, bei Erteilung der Erlaubnis sei die Sicherheit oder Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs nicht gewährleistet (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 BtMG). Mit dieser Begründung kann das angefochtene Urteil schon deshalb nicht aufrechterhalten werden, weil eine substantiierte Prüfung hierzu selbst durch die Behörde nicht erfolgt ist. Der generelle Hinweis auf die Strafbarkeit des Umgangs mit Cannabis reicht insoweit jedenfalls nicht aus, weil § 3 Abs. 2 BtMG auf eine partielle Legalisierung dieses Umgangs zielt.
6. Internationales Recht steht einer Entscheidung zugunsten des Klägers nicht entgegen. Im Ausgangsbescheid war hierzu auf § 5 Abs. 2 BtMG in Verbindung mit dem Einheits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Februar 1977 (BGBl II S. 111) Bezug genommen worden. Zum einen bringt das Einheits-Übereinkommen in Art. 2 Abs. 5 b, Art. 19 Abs. 1 a, Art. 21 Abs. 1 a, Art. 30 Abs. 1 c und Art. 32 zum Ausdruck, dass der therapeutische Einsatz von Suchtstoffen nicht verhindert werden soll (vgl. Körner, a.a.O., § 3 Bd. 56). Zum anderen stellt § 5 Abs. 2 BtMG die Versagung der Erlaubnis mit der Begründung, sie stehe der Durchführung der internationalen Suchtstoffübereinkommen entgegen, ins Ermessen der Behörde.
7. Das Fehlen zwingender Versagungsgründe rechtfertigt es nicht, die Beklagte entsprechend dem Antrag des Klägers zur Erteilung der Erlaubnis zu verpflichten, vielmehr steht die Erlaubnis im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. Eine Ermessensentscheidung ist bis jetzt nicht getroffen worden, da sich das BfArM aus Rechtsgründen an einer Stattgabe gehindert gesehen hat. Ebenso fehlt es bislang an einer Prüfung, der §§ 5 und 6 BtMG, insbesondere von § 5 Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 6 Abs. 2 BtMG.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO.